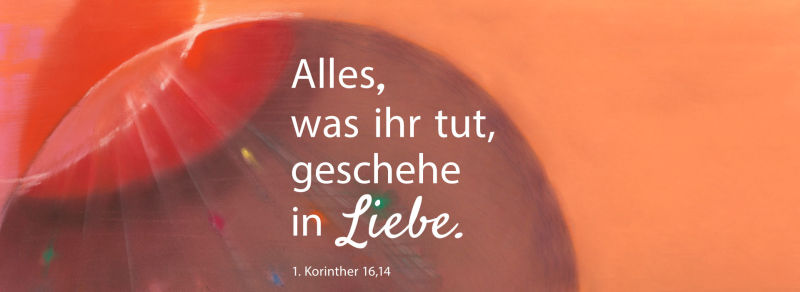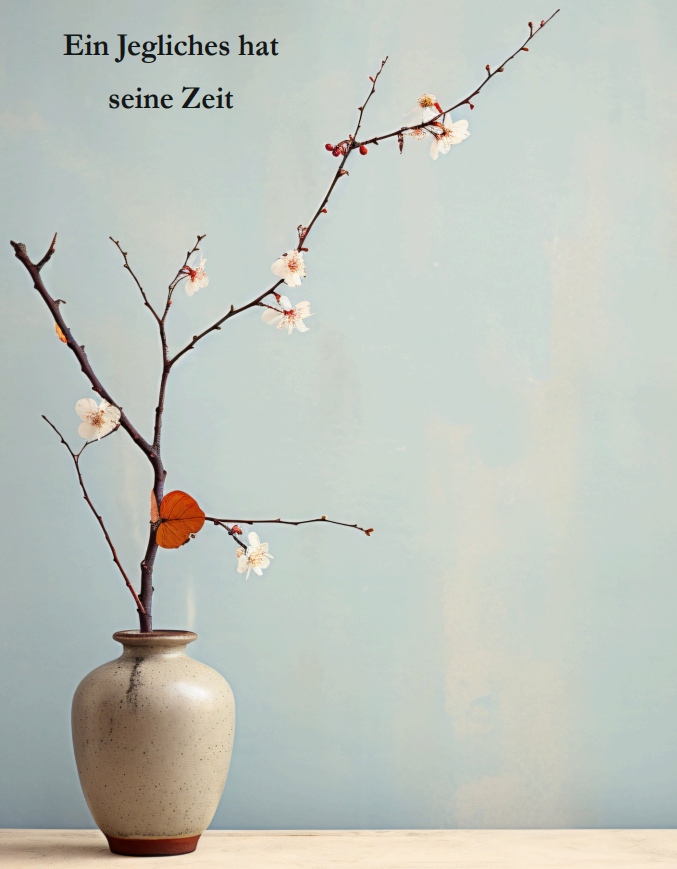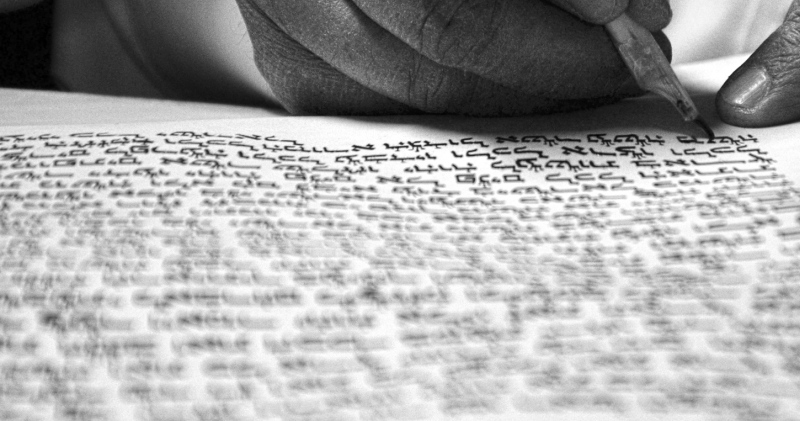Es ist viele Jahre her, da habe ich eine so stressige Gemeindesituation erlebt, da hat der Kantor zu mir gesagt: „Ich komme überhaupt nicht mehr zum Üben.“ Ich dachte bei mir „ich auch nicht“ und begann erst dann zu überlegen, wie die Übung einer Pfarrerin aussieht. Ich muss gestehen, die Frage hat mich einige Jahre begleitet, doch inzwischen kann ich sie klar und deutlich beantworten: Beten.
Die Übung einer Pfarrerin ist beten, weil die Übung gläubiger Menschen beten ist. Damit meine ich nicht, in ausschweifenden Reden Gott die Welt erklären, ich meine damit auch keine Hilferufe, die wir als Stoßgebete dann aussenden, wenn uns nichts anderes mehr zu tun einfällt und vor allem meine ich damit keine Selbstdarstellungen religiöser Leute. Ich meine damit, da sein. Gottes Geschenke auspacken und annehmen. Das Leben nicht weiter vor sich herschieben, sondern leben. Ja, das kann mensch üben. Wir nennen diese Übungen gerne Kontemplation, Meditation, Konzentration, Fokussierung, Präsenz, Sitzen, Trance … und ab und an auch Gebet.
In der Passionszeit habe ich es Herzensgebet genannt. Immer mittwochabends waren die Treffen. Wir saßen im Kreis und haben geatmet. Zehn Minuten lang. Beim Einatmen haben wir „Jesus Christus“ gedacht und beim Ausatmen „erbarme dich meiner.“ Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, die helfen, aus dem Gedankenkarussell auszusteigen – ein Nickerchen ist keine davon.

Auch meine Faszination für Klöster hat damit zu tun, dass Klöster Orte des Gebets sind. Räume, die viel Zeit zum Beten bieten. Vielleicht haben Sie Zeit, mit zum Gemeindeausflug ins Kloster Chorin zu kommen. Obwohl wir zum Beten überhaupt nirgendwo hin müssen, kann ich mir gut vorstellen, dass bei diesem Ausflug Gebet passiert. Wie schön, wenn wir dabei sind, wenn Gebet passiert.
Ich bin noch immer damit beschäftigt, alles und alle kennen zu lernen. Falls Sie das mit dem Beten völlig anders sehen, oder schlicht nicht glauben können, was ich darüber so erzähle, dann freue ich mich ganz besonders, wenn Sie auf mich zukommen und wir gemeinsam übers Beten schnacken … und wer weiß … vielleicht auch … zusammen … beten …?
Carmen Khan